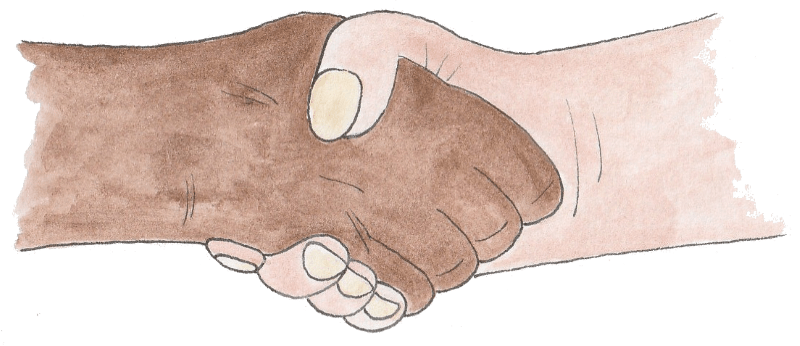
Vorbild sein – Werte vorleben
Kinder lernen Werte nicht durch Worte, sondern durch Vorbilder. Im pädagogischen Alltag bist du immer auch eine „Wertebotschafterin“ – jede Geste, jede Reaktion, jeder Umgang mit Konflikten vermittelt unbewusst, was „richtig“ oder „wichtig“ ist.
Das bedeutet: Werteerziehung geschieht nicht zusätzlich, sondern in jeder Alltagssituation – beim Aufräumen, Trösten, Diskutieren oder Lachen.
Nach Albert Banduras Lerntheorie prägen sich Kinder Verhalten ein, das sie beobachten, besonders von Bezugspersonen, die sie schätzen oder als Autorität erleben.
Das heißt:
- Kinder übernehmen Werte, die sie erleben, nicht die, die ihnen erklärt werden.
- Sie beobachten, wie Erwachsene mit Fehlern, Kritik oder Verantwortung umgehen.
- Besonders prägend sind emotionale Situationen – hier werden Werte gefühlt und verinnerlicht.
Kinder lernen am Modell, weshalb das Verhalten von pädagogischen Fachkräften eine der nachhaltigsten Quellen der Wertevermittlung ist. Durch Nachahmung übernehmen Kinder nicht nur sichtbare Handlungen, sondern auch Haltungen und Einstellungen. Daher ist es essenziell, dass wir uns als Fachkräfte unserer Worte, Handlungen und Körpersprache bewusst sind, da sie eine direkte Wirkung auf die Kinder haben. Authentizität spielt hierbei eine zentrale Rolle, denn Kinder sind sehr feinfühlig und bemerken, wenn unser Verhalten nicht mit unseren Worten übereinstimmt. Sollten wir dennoch einmal Werte verletzen oder uns widersprüchlich verhalten, ist es wichtig, dies offen mit den Kindern zu besprechen, um Glaubwürdigkeit zu wahren und sie im Umgang mit solchen Situationen zu stärken. Beispielsweise könnte es passieren, dass man in Eile ein „Bitte“ vergisst, obwohl man den Kindern Höflichkeit vermittelt. In einem solchen Fall sollte man sich bei den Kindern entschuldigen und erklären, dass auch Erwachsene manchmal Fehler machen, aber bereit sind, daraus zu lernen. Ebenso gilt es, eigene Regeln zu beachten und Ausnahmen transparent zu machen, damit sie für die Kinder nachvollziehbar bleiben.
| Situation | Weniger wertschätzendes Handeln | Wertschätzendes Handeln |
|---|---|---|
| Aufräumen | „Du machst nie, was man dir sagt! Wenn du nicht aufräumst, kannst du auch nicht mitspielen.“ → Dieses Verhalten wirkt herabwürdigend, verallgemeinert das Verhalten des Kindes („nie“) und setzt es unter Druck, ohne auf die Gründe einzugehen. | „Ich sehe, dass du gerade nicht aufräumen möchtest. Gibt es einen Grund dafür? Wenn wir zusammen aufräumen, sind wir schneller fertig, und danach können wir etwas Schönes machen.“ → Hier wird das Kind ernst genommen, indem nach den Gründen gefragt wird, anstatt es abzuurteilen. Durch das Angebot zur Zusammenarbeit und positive Motivation wird eine respektvolle Atmosphäre geschaffen, die das Kind unterstützt. |
| Trost spenden | „Jetzt hör auf zu weinen, das war doch gar nicht so schlimm. Stell dich nicht so an.“ → Dieses Verhalten verharmlost die Gefühle des Kindes und vermittelt, dass sein Schmerz nicht ernst genommen wird, was das Kind möglicherweise verletzt oder beschämt. | „Oh, das hat bestimmt wehgetan! Komm, ich schaue mir das mal an. Möchtest du kurz auf meinem Arm sitzen oder mir erzählen, was passiert ist?“ → Hier wird das Gefühl des Kindes ernst genommen, und es wird mit Nähe, Empathie und der Möglichkeit zur Kommunikation getröstet, wodurch sich das Kind verstanden und sicher fühlt. |
| Körperpflege | Dem Kind wortlos die Nase putzen. | Das Kind vorher fragen, ob man ihm die Nase putzen darf. |
| Essen | Verlangen, dass das Kind leer isst. | Das individuelle Sättigungsgefühl des Kindes wird respektiert. |